 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Wozu soll das aber gut sein |
|
|
|
|
|
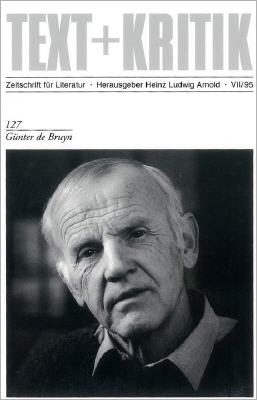
|
|
|
|
|
|
Flanieren in der Diktatur - Der Flaneur Günter de Bruyn, ein Zeitgenosse
Ende der 1950er Jahre erwanderte Günter de Bruyn - zu jener Zeit Bibliothekar in Ost-Berlin - die ländliche Umgebung der Stadt zusammen mit einem Freund. Sie nannten es "Vagabundieren", wenn es sie "auf Landstraßen und Waldwegen zu Kirchen, Schlössern und historisch bedeutsamen Orten trieb". Aktuelle Kunst- oder Reiseführer gab es nicht für ihre Ziele und auf Landkarten war wenig Verlass. Das individuelle Erkunden war zu DDR-Zeiten eher suspekt, und so konnte es vorkommen, dass ein Volkspolizist "Ziel und Zweck der Reise wissen wollte und auf ausführliche Erklärungen immer wieder fragte, wozu aber das gut sein soll".
Die Reiseziele erkundeten sie anhand der Vorkriegsliteratur über Kunst und Geschichte, wobei die Veränderungen "durch Krieg und sozialistischen Nachkrieg" vorher nicht abzusehen waren. Reichsbahnfahrpläne halfen ihnen, die "kunstlosen Strecken" mit der Bahn zu überwinden. Es erwies sich als schwierig, Übernachtungsmöglichkeiten vorher zu reservieren, weil kaum jemand auf individuell Reisende eingestellt war, Kollektive hatten Vorrang. Für die "Schönheit der Vergangenheit" liefen sie sich die Füße blutig, denn nicht selten war ihr Ziel eine Stelle, "an der einmal etwas gewesen war". Wie Theodor Fontane flanierten - wanderten - sie in Brandenburg, bis de Bruyn Schriftsteller wurde, Erzählungen schrieb und damit in eine neue Lebensphase trat. Erst mehr als dreißig Jahre später hat sich de Bruyn literarisch "seinem" Brandenburg genähert.
Eine Biografie zwischen Ost und West, zwischen Stadt und Land, unter vier politischen Systemen (Weimarer Republik, Nazireich, DDR, Bundesrepublik) - das ist Günter de Bruyn, der über 90jährige Schriftsteller und Flaneur.
|
|
|
|
|
|
Jugend in Berlin-Britz
Zweieinhalb Zimmer, in denen sechs Personen leben müssen. Das gab es nicht nur in den Arbeiterquartieren - den Mietskasernen während der industriellen Revolution -, sondern auch noch in der Weimarer Republik, als Neues Bauen sozialen Missständen entgegenwirken sollte. Günter de Bruyn beschreibt die Wohnverhältnisse, in die er 1926 hineingeboren wurde in der Krugpfuhlsiedlung in Britz, die zeitgleich mit der benachbarten Hufeisensiedlung erbaut worden war:
|
 |

mit KLICK vergrößern
|
|
|
|
|
|
"Mein ältester Bruder bewohnte die nicht heizbare Kammer; die siebenjährige Schwester mußte im Wohnzimmer, ich Kleinkind bei den Eltern schlafen, und für den fünfjährigen Bruder wurde abends in der Küche ein Ziehharmonikabett aufgestellt".
Aber die Wohnung hatte Elektrizität und ein Bad und statt Hinterhöfen sah er "Parks und Wiesengrün", wenn er aus dem Fenster schaute. In östlicher Richtung konnte er über den Teltowkanal hinweg bis nach Johannisthal sehen, die Kleingartenanlagen beidseits des Kanals gab es damals noch nicht. Die Kinder bildeten Cliquen, zu ihren Freuden gehörte die Rebhuhnjagd. Morgens kamen von Pferden gezogen der Bierwagen, der Kohlenhändler oder der Einspänner vom Gut Britz zum Tauschgeschäft "Brennholz für Kartoffelschalen" durch die Siedlung gefahren. Mit der Elektrischen (Straßenbahn) brauchte man eine Stunde bis zum Hackeschen Markt, heute erreicht man dieses Ziel mit einmal umsteigen in der U-Bahn in 40 Minuten.
Sein Vater - ein "bayrischer Patriot" - war Handlungsgehilfe und erfolgloser Schriftsteller. Die Vorfahren waren im 15. Jahrhundert aus Holland nach Deutschland gekommen. Die Mutter - Tochter eines preußischen Briefträgers - war zum Katholizismus konvertiert, das schütze den Jungen "vor den Zumutungen der nationalsozialistischen Ideologie und Sprache".
Kinobesuche waren ein Fest für die Kinder. Von den vier zu Fuß erreichbaren Kinos wählte der Vater die Britzer Kammerspiele, die schäbig, eng und muffig, aber 10 Pfennig pro Person billiger waren als die anderen Kinos. Vor dem Hauptfilm gab es Kulturfilm und Wochenschau. In der Pause boten Platzanweiserinnen mit weißen Schürzchen Eis am Stiel aus umgehängten Kästen an.
Vor der Machtübernahme durch die Nazis wurde der Kampf um die richtige politische Anschauung nicht nur auf der Straße, sondern auch mit Flaggen an den Häusern geführt. "Die roten Fahnen waren in der Minderzahl; die schwarz-weiß-roten und die nazifarbenen hielten sich die Waage; doch an der Spitze lag das Schwarz-Rot-Gold."
Es gab Gerüchte, dass nebenan in der Hufeisensiedlung "Gewerkschafter, Sozialdemokraten und Kommunisten aus Einfamilienhäusern vertrieben wurden, um Leuten von Partei und SS Platz zu machen – darunter, wie ich später erfuhr, einem der entsetzlichsten Männer des Dritten Reiches, Adolf Eichmann".
In der Jugendorganisation der Nazis, der Hitler-Jugend, fand de Bruyn statt des erträumten Fahrtenlebens die Vorbereitung auf Kasernenhof und Gefecht. Es war wie ein Gang ins Manöver, "durch die Dörfer mußte im Gleichschritt marschiert werden". Luftschutzkeller sowie Feuerpatschen und Sandsäcke auf den entrümpelten Hausböden begleiteten die Kriegstage. Zum Einkauf brauchte man Lebensmittelkarten. "Blaue Reichsfleisch-, hellblaue Reichsmilch-, gelbe Reichsfett-, rote Reichsbrot- und braune Reichsseifenkarten". Nicht benötigte Kartenabschnitte tauschte man mit anderen. Zur Schule musste er irgendwann nicht mehr gehen, "Lernen wurde auf die Zeit nach dem Endsieg verschoben", die Jugend wurde im Krieg gebraucht.
Im Jahr 1943, de Bruyn war als Flakhelfer eingesetzt, zerstörte eine Luftmine sein Elternhaus. Die Rückseite des Mehrfamilienhauses war eingestürzt, zwei Zimmer der eigenen Wohnung auf der Vorderseite hingen offen im zweiten Stock. "Meine Kindheit war nun wohl wirklich zu Ende", schreibt de Bruyn. Erstaunt stellt er fest, wie Bombengeschädigte auf ihren Verlust reagieren: "Niemand fragte nach den Kriegsursachen. Sie verwünschten weder den Feind noch den Hitler, sondern den Krieg schlechthin".
In Brandenburg
Nach Kriegsende wurde den Bruyn als Neulehrer ausgebildet. Die Ausbildung dauerte ein halbes Jahr und war damit wesentlich gründlicher als die Unterweisung der heutigen "Quereinsteiger" in den Schuldienst, die erst on the fly bröckchenweise das theoretische Rüstzeug zugefüttert bekommen. Im havelländischen Dorf Garlitz unterrichtete er von 1946 bis 1949 an der Volksschule. Bei zwei Vermieterinnen nacheinander bezog er möblierte Zimmer, und beide wollten ihre Töchter an ihn verkuppeln. Aus der ersten gemieteten Kammer zog er um in den ehemaligen Ziegenstall der zweiten Wirtin, "und hier gefiel ihm auch die Tochter", sagt man im Dorf, sie wurde seine erste Ehefrau.
|
|
|
|
|
|
Wieder in Berlin
Danach kam er nach Berlin zurück, arbeitete als Bibliothekar zunächst in der Stadtbücherei Brunnenstraße und wurde dann wissenschaftlicher Mitarbeiter des Ost-Berliner Instituts für Bibliothekswesen der DDR. Später als Schriftsteller war er im Vorstand des DDR-Schriftstellerverbandes und des DDR-PEN-Zentrums.
|
 |

mit KLICK vergrößern
|
|
|
|
|
|
Seine Werke waren nicht angepasst, sondern schilderten "bedrückende Erfahrungen aus dem DDR-Alltag: Opportunismus, Verdrängung, Schönfärberei, Rituale der Disziplinierung", wie Wolfgang Thierse in einer Laudatio sagte. Dabei versteckte de Bruyn seine Kritik so subtil in den Charakteren seiner Erzählungen, dass sie von der Zensur oft nicht bemerkt wurde.
"Nachdem ich in Romanen und Erzählungen lange um mein Leben herumgeschrieben habe, versuche ich jetzt, es direkt darzustellen, unverschönt, unüberhöht, unmaskiert". Das schreibt Günter des Bruyn einleitend zu seinen Jugenerinnerungen ("Zwischenbilanz", 1992). Er ist als Mensch eher zurückhaltend, fast schüchtern. Redlichkeit und preußische Gradlinigkeit bestimmen seine Geisteshaltung. In der Diktatur ist er durch sein unauffälliges Wesen nie in totalen Gegensatz zur herrschenden Ideologie gekommen, auch wenn "ihm die Leidenschaft für die Sache der Arbeiterklasse fehlte".
Der Anpassungsdruck in der DDR hat dazu geführt, dass er sich in seinem Handeln manchmal erbärmlich fühlte. So hatte er bei einer Lesung in West-Berlin 1964 bei Fragen zum Mauerbau mit seiner Meinung hinter dem Berg gehalten, nur drum herum geredet. Eine Enttäuschung für seine Freunde im Westen, aber in der DDR wurde diese "loyale Haltung" gewürdigt genau wie die Tatsache, dass er freiwillig in den Osten zurückgekehrt war(!).
"Dass mir vor öffentlichen Auftritten stets grauste, hing zwar auch mit meinem Naturell zusammen", schreibt de Bruyn. Es war aber auch darin begründet, dass die Wahrheit, die nach außen drängte, mit den Sprachregelungen in Widerspruch stand, nach denen er sich zu richten versuchte.
Die dunklen Tage der DDR
De Bruyn hat sowohl den Arbeiteraufstand im Juni 1953 als auch den Mauerbau im August 1961 als Zeitzeuge miterlebt. Die Straßen rund um seinen Arbeitsplatz - der Staatsbibliothek zwischen Dorotheenstraße und Unter den Linden - waren bei dem Arbeiteraufstand im Zentrum des Geschehens. Der Lärm der Panzerkolonnen auf dem Pflaster und die Ansammlung der Streikenden bestimmten das Bild. Die Menschenmenge bewegte sich Unter den Linden auf den Gehwegen, der Promenade und der Fahrbahn, es "war nicht recht auszumachen, wer Protestierer und wer Zuschauer war". Dann fielen Schüsse, und alles stob, so schnell es konnte, davon.
Der Wechsel zwischen Osten und Westen war ihm vor dem Mauerbau zur Gewohnheit geworden, und so fuhr er mit der U-Bahn nach Britz (West-Berlin), wo er nahe der Hufeisensiedlung aufgewachsen war und lief von da aus zu seiner Wohnung nach Oberschöneweide (Ost-Berlin). In Britz lag alles in tiefstem Frieden, in Oberschöneweide beherrschten Volkspolizisten die Fahrbahn, während die Menschen sich auf den Bürgersteigen drängten. Wer sich mit Schritten oder Bemerkungen hervorwagte, wurde auf bereitstehenden Lastwagen abtransportiert. Der Rest ist bekannt: Der Aufstand wurde niedergeschlagen, nach offizieller Lesart siegte die Arbeiterklasse mit Hilfe der sowjetischen Freunde über einen faschistischen Putsch.
Als am 13. August 1961 die Mauer gebaut wurde, lebte de Bruyn in Berlin Mitte, das im Norden, Süden und Westen von den Westsektoren umschlossen war. Zu Fuß konnte er alle Grenzen in zehn bis zwanzig Minuten erreichen. Hüben und drüben standen Zivilisten, zwischen ihnen bewegten sich die Uniformierten, drohend oder Stacheldraht ausrollend. Der Friedhof in der Bergstraße war gesperrt, die Leute wurden zur Invalidenstraße zurückgedrängt.
Seitdem träumt er nachts einen umgekehrten Mauertraum: Die Mauer versperrt die Rückkehr in die Heimat, als er aus der Welt draußen zurückkehren will, er ist in der Fremde ausgesperrt. Erst im Erwachen wird ihm klar, dass es die Heimat seiner Jugend in Britz ist, die jetzt unerreichbar in West-Berlin liegt, der Traum hat alles verkehrt.
Als die Mauer im November 1989 fiel, suchte er die Stätten seiner Kindheit in Britz auf. Am Grenzübergang sah er überwiegend junge Leute, die beim Mauerbau noch gar nicht geboren waren und nun in ein fremdes Terrain vorstießen, schon ahnend, dass sie auf der Westseite die ahnungslosen Provinzler sein würden. Er begriff, dass er bald zu denen gehören würde, deren Erfahrung nur noch für Historiker interessant sind.
Wieder in Brandenburg
Mehr als dreißig Jahre nach seinem "Vagabundieren" auf Landstraßen und Waldwegen in Brandenburg folgte die literarische Umsetzung, sich „ins Märkische und Historische zu begeben". Wie Theodor Fontane recherchiert er akribisch in historischen Dokumenten, um ein Bauwerk oder einen Ort vor unseren Augen erstehen zu lassen, bringt Örtlichkeiten und ihre Geschichte zusammen ("Mein Brandenburg", 1993). Ein Kritiker bemängelt, dass es etwas eintönig sei, wenn er "siebzehn Seiten lang aus einer Kirchenchronik zitiere", aber das ist sicherlich übertrieben. Für die ruhige Schlichtheit und melancholische Schönheit der märkischen Landschaft muss man einen feineren Natursinn entwickeln. "Es gibt Straßen und Dörfer, die zum Durchfahren und solche, die zum Bleiben einladen, und das hat auch etwas mit Bäumen zu tun".
|
|
|
|
|
|
Im Alter hat de Bruyn sich an einen verwunschenen Ort in Brandenburg zurückgezogen, den er bereits 1967 auf einer "Expedition" mit einer munteren Reisegesellschaft erkundet hat: Die Blabbermühle im Oder-Spree-Kreis. Der plattdeutsche Name für plappern steht lautmalerisch für das Geräusch der arbeitenden Mühle.
|
 |

mit KLICK vergrößern
|
|
|
|
|
|
Der Blabbergraben ist ein Rinnsal "das sein Wasser, ohne einen Ort zu berühren, zwischen den sandigen Hochflächen hindurch der Spree zuführte und zwei Mühlen bewegte, die Verbindung zwischen fünf Seen herstellte, nicht beflößt wurde und auch nicht schiffbar war. Da die Mühlen, wie man aus Erfahrung wußte, inzwischen wahrscheinlich Ruinen waren, schien das einzig Sehenswerte der Gegend also die Abwesenheit von Mensch und Kultur zu sein". Das alte Schäferhaus an der nicht mehr vorhandenen Mühle hat de Bruyn 1968 herrichten lassen. Irgendwann ist er dorthin "lautlos verschwunden". Es heißt, ihn selbst sehe man sehr selten. "Ein ganz zurückgezogen lebender Mensch, ein Schriftsteller eben".
24. September 2018
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ein spiritueller Flaneur
Etwas Großes als groß begreifen
|
|
 |
|
 |